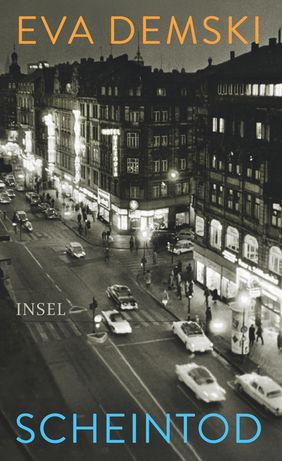Das Frankfurter Publikum scheint nach Einschätzung einiger Kultur- und Literaturmäzene besonders anspruchslos zu sein. Das zeigt sich auch bei manchen Titeln, die von der Jury „Frankfurt liest ein Buch“ für die öffentliche Auseinandersetzung mit literarischen Werken ausgewählt wurden. Tatsächlich jongliert das offiziöse Frankfurt immer wieder zwischen Kitsch und Kultur, zwischen missglückten Versuchen und dem Unterbleiben wegen Nichtkönnens. So fällt mir spontan keine Stadt in Deutschland ein, die ihre Theateranlage, die 1963 beispielhaft als offenes und einladendes Gebäude auf den Grundmauern der alten errichtet worden war, so konsequent verkommen ließ und sie letztlich der Immobilienmafia überantwortete.
Für das Jahr 2021 fiel die Wahl der Jury auf Eva Demskis Roman „Scheintod“. Das Buch ist 1984 im Hanser Verlag, München, erschienen. Bereits damals lobte ihn der Werbetext auf der Umschlagklappe als „Roman einer gescheiterten Liebe". Dieses Scheitern manifestiert sich erkennbar in einer Sprache, die frei ist von jeglicher Empathie für den toten Ehemann. Und die von extremer Kunstlosigkeit geprägt ist. So heißt es durchgehend „der Mann“ und „die Frau“. Talentierte Schriftsteller sind dazu in der Lage, notwendige Distanzierungen anders, nämlich literarisch, auszudrücken. Folglich liest sich die Erzählung über weite Strecken wie ein missglücktes Protokoll, in dem alles Persönliche untergeht und in der unnötigerweise alles abstrahiert wird. Dabei sind die Aussagen, welche „die Frau“ über „den Mann“ trifft, keineswegs allgemeingültig, sondern betreffen im Wesentlichen den Mikrokosmos einer Ehe.
Der Roman spielt während 12 Tagen vor und nach Ostern 1974. Der Strafverteidiger Reiner Demski wird in seiner Wohnung im Frankfurter Bahnhofsviertel tot aufgefunden, anscheinend ist er einem Asthmaleiden erlegen. Die Polizei ordnet dennoch eine Obduktion an. Denn Demski galt als Exzentriker, vernetzt mit linksextremen Aktivisten und er war bekannt geworden durch die Verteidigung von Gudrun Ensslin im Frankfurter Kaufhausbrandstifter-Prozess. Von seiner Ehefrau Eva Demski lebte er bereits seit mehreren Jahren getrennt. Es liegt nahe, das Motiv dieses Romans in der Suche einer Witwe nach Ursachen zu vermuten. Denn sie hatte lange mit einem Menschen zusammengelebt, der ihr offenbar unbekannt geblieben war. Um in diese Hinter- und Untergründe einzutauchen, wäre eine sehr persönliche Reflexion notwendig gewesen. Aber exakt vor dieser Analyse schreckt die Autorin zurück, flüchtet sich in eine Dramaturgie, die Unglaubwürdigkeit hervorruft.
Dieses Stilmittel verhindert auch, dass „Scheintod“ als Schlüsselroman gelten kann. Nämlich für Ereignisse in der linksradikalen Terrorszene der späten 1960er und frühen 1970er Jahre. Etwa über die „Bewegung 2. Juni“, die „Bader-Meinhof-Gruppe“, die sich als „RAF – Rote Armee Fraktion“ bezeichnete. Als eine solche Enthüllung, zumindest die der Frankfurter Szene, wurde er jedenfalls beim Ersterscheinen überwiegend verstanden. Literarische Ingredienzien haben die Rezensenten hingegen nicht gefunden.
Selbst die Auseinandersetzung „der Frau“ mit ihren streng katholischen Schwiegereltern bietet keine Antworten auf Fragen nach dem, was Reiner Demski eigentlich umgetrieben hat. Schon gar nicht wird seine Rezeption von politischer Theorie und Praxis transparent gemacht. Es bleibt lediglich ein sehr kurzer Blick in das Frankfurt der frühen 1970er Jahre übrig.
Im Jahr 2000 veröffentlichte der Schöffling Verlag, Frankfurt, den Roman erneut. Möglicherweise hat dessen seinerzeitige Mitgesellschafterin Eva Demski darauf gedrungen. 2014, vierzig Jahre nach den beschriebenen Ereignissen und dreißig Jahre nach der Erstauflage, erschien er ein weiteres Mal, diesmal im Insel Verlag, Berlin. Der legte mittlerweile eine Sonderausgabe vor, mutmaßlich, weil die Jury „Frankfurt liest ein Buch“ den Roman zum Titel des Jahres 2021 erkoren hatte.
Nach Gerd Koenens ausführlicher Analyse „Das rote Jahrzehnt“ (2001) und seiner Geschichte des Kommunismus („Die Farbe Rot“, 2016) gibt es allerdings wenig Gründe für die Beschäftigung mit der Thematik aus einer doch sehr engen Perspektive.
Eva Demskis Roman kann man lesen, aber man muss ihn nicht unbedingt lesen und er liefert wenig Stoff für eine je eigene Meinungsbildung.
Als das Projekt „Frankfurt liest ein Buch“ 2010 mit Valentin Sengers Erinnerung „Kaiserhofstraße 12“ startete, war das ein gelungener Versuch, das bereits 1978 erschienene Buch dem Vergessen zu entreißen. Sengers autobiografische Schilderung über Leben und Überleben seiner Familie, der es gelang, sich vor dem mörderischen Nazi-Staat zu tarnen, war zwar nicht hochliterarisch, aber es bewegte den Lesern und kann ohne Abstriche als ein unverzichtbares zeitgeschichtliches Dokument gelten.
Mit Wilhelm Genazinos „Abschaffel“, folgte 2011 eine literarisch gelungene Satire auf die Arbeitswelt der Angestellten. Auch sie lag bereits seit drei Jahrzehnten vor, was aber der Qualität der Trilogie keinen Abbruch tat.
Silvia Tennenbaums „Straßen von gestern“ war eine wichtige Neu- und Erstbegegnung mit der jüdischen Geschichte Frankfurts.
Doch dann schien das Repertoire an Lesenswertem zunächst ausgeschöpft zu sein.
Siegfried Kracauers „Ginster“, ein Soldatenleben im Ersten Weltkrieg, war völlig untypisch für den kritischen Journalisten (2013), der 1930 eine detaillierte Studie über die Angestellten am Ende der Weimarer Republik vorgelegt hatte.
Eckhard Henscheids „Die Vollidioten“ konnte nur als extrem schlichter Nachgesang auf jene 68er durchgehen, die es so, wie geschildert, gar nicht gegeben hatte (2014).
Mirjam Presslers „Grüße und Küsse an alle“ war erkennbar von guter Absicht getrieben, aber literarisch misslungen. Das Buch vermochte wenig zur Geschichte von Anne Franks Familie beizutragen (2015).
Dieter David Seuthes Erzählung „Frankfurt verboten“ erwies sich als eine synthetische historische Darstellung, der es an Authentizität mangelte und die schriftstellerisch zu wünschen übrig ließ (2016).
In Herbert Heckmanns „Benjamin und seine Väter“, bereits 1962 erschienen, waren Frankfurts Bewohner, Straßen und Plätze eigentlich austauschbar. Das wenig akzentuierte Geschehen hätte sich auch in Gelsenkirchen oder Pforzheim ereignen können. In diesen autobiografischen Reminiszenzen suchte man vergebens sowohl nach eindeutigen lokalen Bezügen als auch nach erzählerischen Höhepunkten (2017).
Erst Anna Seghers „Das siebte Kreuz“ war ein gelungener Aufbruch, der erneut literarische und zeitgeschichtliche Maßstäbe setzte (2018).
Martin Mosebachs „Westend“ muss hingegen als ein Einbruch in literarische, philosophische und politische Abgründe gewertet werden. Der Büchner-Preisträger ist bekanntlich Anhänger einer autoritär-katholischen Weltanschauung, die auf Distanz zur Demokratie geht. Insbesondere der antimodernistische Philosoph Nicolás Gómez Dávila hat es ihm angetan. Bei seiner Laudatio zur Büchner-Preisverleihung 2007 kam es zu einem Skandal, der sich anscheinend nicht bis in die Jury von „Frankfurt liest ein Buch“ herumgesprochen hatte. In seiner Dankesrede hatte Mosebach eine Rede Heinrich Himmlers mit einer des Jakobiners Saint-Just aus Georg Büchners „Dantons Tod“ verglichen. Zudem scheint Mosebach, der Frankfurt nach seinen eigenen Worten als „eine der verdorbensten und hässlichsten Städte Deutschlands“ erlebt, das Quartier Westend nur aus zweiter Hand zu kennen (2019).
Erich Kubys Kolportageroman „Rosemarie – Des deutschen Wunders liebstes Kind“ aus dem Jahr 1958, der 2020 das Thema von „Frankfurt liest ein Buch“ war, scheint mir ein weiterer Beleg dafür zu sein, dass das offiziöse Frankfurt nach wie vor ein gestörtes Verhältnis zur Kultur besitzt.
Klaus Philipp Mertens