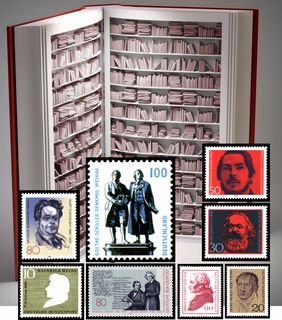Die Literatur müsse diverser werden, fordert eine kleine, aber lautstarke Interessensvertretung von Autorinnen und Autoren, die bis in manche Feuilletons hinreicht. Überwiegend handelt es sich um Schriftsteller, die wenig bis gar nicht wahrgenommen, und falls doch, wegen deutlicher literarischer Schwächen kritisiert werden. Dieses Übersehen läge nach Einschätzung der Betroffenen jedoch nicht an mangelhafter Literarität der Veröffentlichungen. Sondern entweder an der ethnischen Herkunft der Autoren oder an deren geschlechtlicher Identität bzw. sexueller Orientierung. Allerdings weisen Literaturkritik und Literaturwissenschaft mehrheitlich darauf hin, dass literarische Qualitäten nicht an den erwähnten Eigenschaften der Verfasser festgemacht werden dürfen, sondern ausschließlich an schriftstellerischer Kunstfertigkeit. Die Probleme von Minderheiten riefen zwar neben der politischen auch nach literarischer Bewältigung. Dennoch müssten Erzähler, Lyriker oder Dramatiker in jedem Fall ihr Metier beherrschen. Solches Können sei die Voraussetzung, um Geschehnisse künstlerisch aufzuarbeiten. Ohne eine außergewöhnliche und möglichst geschulte Begabung sei das nicht leistbar.
Die Zugehörigkeit zu einer benachteiligten gesellschaftlichen Gruppe könne Reflexionen auslösen, die sich schriftlich manifestieren. Aber auch dafür würden letztlich literarische Normen gelten. Nur Können kann zur Kunst werden. Schreiben sollen oder wollen hingegen führten in eine Engführung.
Im „Börsenblatt des Buchhandels“, dem Organ des Verbands der Verleger und Buchhändler, wird zunehmend beklagt, dass es sowohl an schwarzer als auch an queerer Literatur mangele.
Hierzu ist anzumerken, dass sich das Börsenblatt dem sogenannten Gendern verpflichtet fühlt, also einer vermeintlich geschlechtergerechten Sprache. De facto lehnt dieses Sprachrohr der wichtigsten Kulturbranche es ab, die deutsche Grammatik und die deutsche Rechtschreibung korrekt anzuwenden (trotz einer gültigen Vereinbarung aller deutschsprachigen Staaten). Es fehlt offensichtlich an der Einsicht, das generische Maskulinum als nichtdinglichen, übergeordneten Begriff zu akzeptieren. Stattdessen wird ihm eine mit Stern, Doppelpunkt oder Unterstrich verbundene weibliche Form (in/innen) angefügt. Grammatik und Rechtschreibung halten für diese Unterscheidung das Konkretum bereit. Beispielsweise „Freundinnen und Freunde“, „Leserinnen und Leser“ oder „Hörerinnen und Hörer“. Das Anhängsel dagegen bedeutet Unterordnung im Sinn von Unterwerfung, nämlich unter die vermutete oder tatsächlich bestehende Herrschaft eines Geschlechts, in der Regel dem der Männer.
Eine ähnliche Umdeutung und ideologische Aneignung der deutschen Sprache wurde in den Jahren der totalen Katastrophe im „Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda“ eines Dr. Joseph Goebbels durchgeführt. Noch heute sind Relikte dieser Manipulation im Umlauf. Ich erinnere an das Wort „Kulturschaffende“, dem die völkische Unterscheidung zwischen „Arbeitern der Stirn und der Faust“ zugrunde liegt. Derzufolge lässt sich Kultur schaffen und formen wie ein Stück heißes Eisen. Oder das Wort „Einsatz“, schlimmer noch: „Angriff“, die der militärischen Sprache entnommen wurden. Durch die Militarisierung des zivilen Alltags im NS-Staat wurde nahezu alles als Einsatz bzw. Angriff („zur Verteidigung der Volksgemeinschaft“) deklariert. Populär wie einst ist nach wie vor die Bezeichnung „Doppelverdiener“. Sie meint nicht jemanden, der zwei Tätigkeiten nachgeht, sondern ein berufstätiges Ehepaar. Der Nazi-Ideologie waren arbeitende Frauen suspekt. Sie sollten ihre vermeintlich festgeschriebene Rolle im Haushalt und bei der Kindererziehung erfüllen. Der totalitäre Staat benötigte Nachwuchs, brauchte unzählige Gefolgsleute für die Unterdrückung der Demokratie und Soldaten für die Kriege, die ab 1939 endgültig an der Tagesordnung waren.
Unlängst machte die Universität Kassel von sich reden, weil eine Dozentin die ihr eingereichten Abschlussarbeiten mit Punkteabzug versah, falls darin nicht gegendert wurde. Dagegen wehrte sich ein Student. Daraufhin beauftragte die Hochschule einen Gutachter, der zu einem „Sowohl als auch“ gelangte. Er bezweifelte zwar nicht die gültige Rechtschreibnorm (die der „Rat für Rechtschreibung“ im Auge hat). Er erkannte aber auch in Ausnahmefällen die Notwendigkeit zur besonderen geschlechtergerechten Sprache. Es ist davon auszugehen, dass ein Verwaltungsgericht das anders beurteilt hätte.
Doch zurück zur „schwarzen Literatur“ bzw. zur Literatur schwarzer Deutscher bzw. Deutscher mit afrikanischen Wurzeln. Niemand hindert diese Bürger daran, ihre Erlebnisse, Eindrücke und Reflexionen zu Papier zu bringen und zu veröffentlichen. Dies gilt auch für Menschen mit einer anderen Geschlechtlichkeit. Die einzige Barriere zwischen persönlichen Aufzeichnungen und öffentlicher Wahrnehmung ist die Beherrschung jener Kulturtechnik, die man literarisches Schreiben nennt. Dies gilt für alle, unabhängig davon, ob man hell- oder dunkelhäutig, Mann oder Frau ist oder sich als queer bezeichnet.
Ich illustriere diese Feststellungen an einem sehr typischen Beispiel. Im Frühjahr 2021 erschien im Claassen Verlag ein Sammelband mit Texten zur sozialen Frage in Deutschland. Er trägt den beziehungsreichen Titel „Klasse und Kampf“. Als Herausgeber zeichnen Maria Barankow und Christian Baron. Einige Geschichten, so die von Arno Frank oder Clemens Meyer, bringen Verhältnisse zur Sprache, die von den regierenden Parteien allzu häufig verschwiegen, zumindest aber für keineswegs allgemeingültig erklärt und somit vom Tisch gewischt werden. Beide Autoren sind auf ihre jeweilige Art Meister der deutschen Sprachkunst, was die Glaubwürdigkeit und Bedeutung ihrer Texte noch zusätzlich unterstreicht. Demgegenüber erweisen sich andere Beiträge als kontraproduktiv, ja, als geradezu konterrevolutionär. Ihre Motive erscheinen, gemessen am Thema des Buchs, als unrealistisch; ihre Sprache wirkt aufgesetzt und statisch. In den beschriebenen sozialen Schichten, vor allem denen der Zuwanderer, spricht so keiner. Und es wird gegendert, was selbst in der indirekten Wiedergabe synthetisch wirkt und zudem grammatikalisch falsch ist. Die Regisseurin Pinar Karabulut hält das mutmaßlich für notwendig, um die Authentizität des Erzählten zu belegen. Doch sie erzielt dadurch die gegenteilige Wirkung. Das hat auch die in Ostberlin geborene Francis Seeck nicht verinnerlicht. Ihre Milieuschilderungen schreien geradezu danach, von einer talentierten Schriftstellerin erzählt zu werden. Denn tendenziell enthalten sie viele unausgesprochene Wahrheiten. Doch die subproletarischen Idiome samt Gendern untergraben die guten Absichten und die Zuordnung in die ernsthafte Literatur.
Ich musste bei der Lektüre immer wieder an jene „Literatur der Arbeitswelt“ denken, die von den 1960er bis zu den 1980er Jahren die Gegenwartsliteratur beeinflusste. Max von der Grün, einer ihrer Hauptvertreter, schrieb zwar ein einfaches, unkompliziertes Deutsch, das aber wegen seiner Natürlichkeit und Eindringlichkeit literarisch war. Ein anderer aus dieser „Dortmunder Gruppe 61“, Josef Reding, pflegte bewusst die am US-Amerikanischen angelehnte Abenteuererzählung in der Form der Kurzgeschichte und führte sie als deutsche Variante in literarische Höhen.
Doch noch einmal zurück zu „Klasse und Kampf“. Die aus London stammende Sharon Dodua Otoo, die afrikanische Wurzeln hat, setzt in diesem Buch einen negativen Höhepunkt. Ihr Sprachstil ist nassforsch bis impertinent, sie gendert und wenn sie sich über deutsche Sozialgesetze auslässt, gibt sie Falschverstandenes wieder. Pech für jene Leser, die das für bare Münze halten und daraufhin Kleinkriege mit Behörden vom Zaun brechen.
Frau Otoo wurde 2016 für ihren Text „Herr Göttrup setzt sich hin“ der Ingeborg-Bachmann-Preis zuerkannt. Worin dessen Literarität besteht, weiß ich nicht; aus dem Wortzusammenhang erschließt sie sich nicht. Zu Ihrer schriftstellerischen Motivation äußerte sie sich im Deutschlandfunk so:
„Ein Ziel, das ich hatte, war, Literatur zu schreiben aus der Perspektive einer schwarzen Frau, einer schwarzen Mutter, weil ich finde, es gibt so wenig darüber in der deutschen Literatur oder in der britischen Literatur, wo es mit Leichtigkeit, mit Humor, mit Irritation arbeitet und diesen Tiefgang trotzdem auch hat. Es hat sich so entwickelt, dass mein Aktivismus jetzt sehr eng verknüpft ist mit Kunst. Zum einen durch mein eigenes Schreiben. Also ich sehe auch meine Literatur als eine Art Intervention, in der deutschen Literaturlandschaft zu sagen: Es gibt sehr viel mehr als wir bisher wahrgenommen haben.“
Das klingt bruchstückhaft, holzschnittartig und sehr wenig schriftstellerisch. Ein so offenkundiges Unvermögen lässt sich auch nicht mit dem Hinweis auf die Ethnie entschuldigen. In ihrem Debütroman „Adas Raum“, der 2021 erschien, setzte sie ihr Stakkato-ähnliches Schreiben fort. Ich war entsetzt. Über die Autorin, aber auch über das Lektorat des S. Fischer Verlags, der so etwas akzeptiert.
In meiner eigenen, über vierzigjähren, Verlagstätigkeit (Programm, Lektorat, Marketing) habe ich solche Verwegenheit nicht gewagt. Ich ließ von den eingegangenen Manuskripten die Angaben zur Person der Autoren vom eigentlichen Text trennen. Denn ich wollte mich auf Stil und inhaltliche Plausibilität konzentrieren. Geschlecht, Ethnie, Nationalität, Konfession, Alter und Beruf des Verfassers spielten für die Beurteilung keine Rolle. Das galt auch für Einsendungen von Agenturen. Erst nachdem die Würfel gefallen waren, kamen die vorher abgesonderten Bestandteile wieder dazu. Im jährlichen Mittel entsprach der Anteil von Frauen und Männern ungefähr der Bevölkerungsstatistik, wobei die Frauen immer leicht überwogen. Auch der Anteil von Minderheiten (damals vor allem Zuwanderer und politisch Verfolgte) entsprach dem Bevölkerungsdurchschnitt.
Daneben war auch immer die Förderung afrikanischer, arabischer und asiatischer Literatur Teil unserer Programmpolitik. Eine besondere Hilfe war mir vom Ende der 70er bis zur Mitte der 80er Jahre der Bremer Schriftsteller Armin Kerker, längere Zeit Programmleiter des Goethe-Instituts in Kamerun. Er vermittelte mir und Kollegen anderer Verlage einen repräsentativen Ausschnitt aus der afrikanischen Nationalliteratur. Gravierendstes Hindernis für eine Veröffentlichung in Deutschland war der Mangel an geeigneten Übersetzern. Sie mussten sowohl die jeweilige Sprache beherrschen als auch mit dem Land gut vertraut sein. Einer meiner Gutachter, der sprachgewandte Michael Molikita aus Ghana, verwarf einen großen Teil der erstellten Probeübersetzungen, weil er darin den Geist Afrikas vermisste.
Wegen vieler Einwanderer hat sich die damalige Situation verändert. Deutschsprachige Autoren mit afrikanischen, arabischen und asiatischen Wurzeln leben und arbeiten hier. Für ihre Manuskripte gilt dennoch die oben erwähnte Regel. Sie müssen sprachlich und inhaltlich überzeugen. Völlig unabhängig von ihren einstigen Herkunftsländern. Eine Quote in der Literatur wäre deren Untergang. Denn Literatur ist Kunst, was Können meint. Wäre es anders, müsste sie Sollst oder Wollst heißen.
Klaus Philipp Mertens