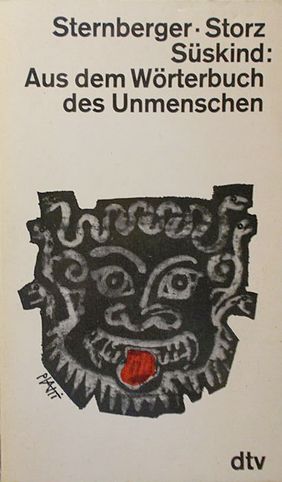Die Corona-Pandemie trägt u.a. dazu bei, dass Menschen offenbaren, wes schrecklichen Geistes Kinder sie sind. So wiesen Mitarbeiter von Schauspiel, Alter Oper, English Theatre und anderen Frankfurter Kultureinrichtungen durch eine Menschenkette auf ihre äußerst schwierige Lage im Lockdown hin. Das ist ihr gutes Recht. Nicht hinzunehmen ist hingegen ihr Selbstverständnis als „Kulturschaffende“. Denn diese Bezeichnung lässt vermuten, dass sie sich für etwas Besseres, geradezu Erhabenes, halten, ja, dass sie diese Tätigkeit – das sogenannte „Kulturschaffen“ – anderen absprechen. Denn wer sich so nennt, geht davon aus, dass andere keine Kultur schaffen (und vielleicht auch keine haben); mutmaßlich die Mehrheit der Bevölkerung. Während meiner Schulzeit (1954 bis 1967) habe ich noch gelernt, dass zur Kultur alles gehört, was der Mensch schafft oder je geschaffen hat, ebenso der Umgang und die je individuelle Beschäftigung damit. Das schloss jeden Menschen ein, nicht nur Schriftsteller, Musiker, Maler, Bildhauer oder Schauspieler.
Die um sich greifende Bildungs- und Gedankenlosigkeit, die sich auch in einer unzureichend reflektierenden Sprache manifestiert, lässt im konkreten Fall völlig außer Acht, dass dieser Begriff noch zusätzlich vergiftet ist. Er tauchte am Ende der 1920er Jahre in antidemokratischen Gruppierungen auf und wurde von den Nationalsozialisten in den erwünschten Sprachgebrauch eingeführt. Im Zuge der so genannten Gleichschaltung konnte das NSDAP-Blatt „Völkischer Beobachter“ bereits 1934 einen „Aufruf der Kulturschaffenden“ veröffentlichen, in dem die Unterzeichner „Treue zum Führer“ gelobten. Damit war die Rolle der „Kulturschaffenden“ im System eindeutig definiert. Sie galten als „Arbeiter der Stirn“ und wurden den „Arbeitern der Faust“ (ebenfalls synthetische Wörter aus Joseph Goebbels Propagandaministerium) an die Seite gestellt.
In der vorgeblich antifaschistischen DDR wurde dieser Ausdruck ohne jegliche Distanzierung vom NS-Staat weiterhin propagiert (Kulturschaffende als Bündnispartner der Arbeiterklasse).
In Westdeutschland gab es immerhin eine Kontroverse um diese und andere Unwörter. Sie wurde in Gang gesetzt durch eine 1946 begonnene Artikelreihe in der Zeitschrift „Die Wandlung“. Darin unterzogen der Politologe Dolf Sternberger, der Literaturwissenschaftler Gerhard Storz und der SZ-Redakteur Wilhelm E. Süskind das von ihnen so benannte „Wörterbuch des Unmenschen“, also den NS-Wortschatz, einer Überprüfung. 1957 erschien eine Buchausgabe, die bis in die 1990er Jahre mehrere Neuauflagen erlebte. Neben „Kulturschaffenden“ wurden auch „Einsatz“, „Härte“, „Propaganda“, „Querschießen“ oder „Sektor“ auf ihre Wurzeln und Umdeutungen untersucht. In ihrem Vorwort schrieben die Autoren: „Dieser gewalttätige Satzbau, diese verkümmerte Grammatik, dieser monströse und zugleich krüppelhafte Wortschatz. Das war nach unserer Meinung der typische Ausdruck der Gewaltherrschaft.“
Ähnlich argumentierte Victor Klemperer in seinem „Notizbuch eines Philologen“, das den bezeichnenden Titel „LTI Lingua Tertii Imperii“ trägt und zunächst in der DDR erschienen war: „Worte können sein wie winzige Arsendosen, sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun, und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung da.“
All das scheint im Bewusstsein jener, die sich heute als Kulturschaffende bezeichnen, nicht angekommen zu sein. Auch nicht bei der Frankfurter Kulturdezernentin, nicht beim Intendanten des Schauspiels und nicht bei der Leiterin des Jüdischen Museums. Es ist eine Schande!
Das „kritische Tagebuch“ wird geführt von Klaus Philipp Mertens